
Die Populationen der Flussperlmuschel (Margaritifera margaritifera) sind seit den 1930er Jahren um über 90 Prozent zurückgegangen. Dies liegt vor allem an der Verschlammung von Gewässerbetten, denn die bis zu 16 cm große holarktische Art benötigt stabile Schotter- und Kiessubstrate mit wenig Feinmaterial. | Illustration: www.studioaden.berlin
Belastende Einflüsse wie der Klimawandel und steigende Bevölkerungszahlen setzen die Süßgewässer überall auf der Welt stark unter Druck. Damit schwinden auch die Lebensräume vieler Arten, die auf bestimmte Bedingungen angewiesen sind, während anpassungsfähige, teilweise invasive Spezies neue Räume erobern können. Welche Entwicklungen waren in den vergangenen Jahrzehnten zu beobachten, und wie werden sich die Trends fortsetzen? Kann man gegensteuern, und was sind sinnvolle Maßnahmen? Mit diesen Fragen beschäftigen sich IGB-Forschende in verschiedenen aktuellen Vorhaben aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Klar ist: Um die biologische Vielfalt in den Süßgewässern weltweit zu erhalten, von denen auch menschliches Leben abhängt, müssen wir handeln.
Weniger Sauerstoff – weniger vielfältiges Leben
Langzeitdaten etwa zu Temperatur oder Nährstoffsättigung zeigen Entwicklungen über mehrere Jahrzehnte; für viele Seen weltweit existieren solche Zeitreihen. Eine Studie unter IGB-Beteiligung hat Daten von knapp 400 Seen und damit über 45.000 Sauerstoff- und Temperaturprofile analysiert, die seit 1941 gesammelt wurden. Diese Langzeitdaten stammen großteils aus der gemäßigten Zone. Die Auswertung zeigt, dass der Sauerstoffgehalt in den untersuchten Seen seit 1980 im Mittel um 6 Prozent an der Oberfläche und um 19 Prozent in der Tiefenzone gesunken ist. Seen verlieren damit etwa drei- bis neunmal schneller Sauerstoff als die Ozeane. Und auch die Temperaturprofile zeigten deutliche Änderungen: In 68 Prozent der untersuchten Seen gehen die Lebensräume für viele Kaltwasserarten zurück.
Zum Beispiel im Stechlinsee: „Die sauerstofffreie Zone dehnt sich an seiner tiefsten Stelle seit etwa zehn Jahren kontinuierlich aus. Das führt dazu, dass der See im späten Herbst ab einer Tiefe von 40 Metern keinen Lebensraum für Tiere wie die endemische Fontanemaräne mehr bietet“, erläutert Hans-Peter Grossart. Auch andere im Stechlin heimische Arten leiden: Fische benötigen eine Sauerstoffsättigung des Wassers von 60 bis 70 Prozent, und auch kleinere Wasserlebewesen, etwa Schnecken, sind auf Sauerstoff angewiesen. Bei null Prozent überleben in Seen nur noch Mikroorganismen.
In von Sauerstoffarmut betroffenen Seen wie dem Stechlin ist meist die geringere Durchmischung das Problem: Die Phase der Stratifizierung, während der sich die obere, sauerstoffreichere und die sauerstoffarme untere Schicht eines Sees nicht mischen, ist länger geworden. Die thermische Schichtung tritt im Frühjahr etwa zwei Wochen eher ein und endet im Herbst zwei Wochen später. In den letzten Jahren hat der dimiktische Stechlinsee mehrmals statt zwei Durchmischungen pro Jahr nur noch eine Durchmischung gezeigt, ist dann also monomiktisch. In beiden Fällen bedeutet das einen in der Jahresbilanz deutlich höheren Sauerstoffverbrauch in den tiefen Wasserschichten.
Fehlt dauerhaft Sauerstoff in der Tiefenzone, setzt sich eine Spirale in Gang: Je sauerstoffärmer ein Seeboden, umso mehr an Eisen gebundener Phosphor (P) wird rückgelöst und ins Wasser freigesetzt und dient nach der Seendurchmischung als wichtiger Nährstoff für das Phytoplanktonwachstum im lichtdurchfluteten Oberflächenwasser. „Man nennt das interne Eutrophierung, denn der See düngt sich quasi selbst“, sagt Hans-Peter Grossart. Je länger die sauerstofffreien Phasen andauern, umso mehr Phosphor wird aus dem Seeboden freigesetzt; die Freisetzung verstärkt sich dann von Jahr zu Jahr nahezu exponentiell. Dieser freigesetzte Phosphor bedingt wiederum eine verstärkte Biomasseproduktion der Algen im darauffolgenden Jahr. Diese Biomasse sinkt zum Seeboden und wird dann durch Mikroorganismen umgesetzt (z.T. „veratmet“), was wiederum verstärkt Sauerstoff verbraucht, der dann den höheren Lebewesen im See fehlt.
Dass die beschriebenen Mechanismen in Gang kommen, hat vor allem zwei Ursachen: zum einen die globale Erwärmung. Sie bewirkt neben der verminderten Durchmischung, dass im Oberflächenwasser Sauerstoff verlorengeht, denn die Sauerstoffsättigung – also die Menge an Sauerstoff, die das Wasser aufnehmen kann – sinkt, wenn die Temperatur steigt. Ein weiterer Grund ist die zunehmende Eutrophierung von Gewässern über menschliche Aktivitäten, durch die etwa Abwässer, Nährstoffe aus der Landwirtschaft oder Abfallstoffe aus Siedlungen in die Seen geraten.
„Man kann Seen restaurieren, indem man während der Wachstumsphase der Algen die Ausfällung von Phosphor mittels Eisen- oder Aluminiumsalzen induziert und gleichzeitig den Seeboden abdeckt und so dafür sorgt, dass kein Phosphor mehr entweichen kann und somit dem Algenwachstum nicht mehr zur Verfügung steht“, sagt Hans-Peter Grossart. Das ist allerdings eine aufwändige und teure Maßnahme, gerade bei größeren Seen. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben die Gefahr bereits vor Jahren gesehen und gewarnt; im Frühjahr 2021 veröffentlichten sie ihren Wissensstand zusätzlich in einem IGB Dossier.
Wärmeres Wasser verändert Lebensgemeinschaften
Auch ein Team um Ben Kraemer und Rita Adrian hat Langzeitdaten von Seen weltweit analysiert. Im Fokus standen dabei langfristige Temperaturveränderungen des Wassers. Die Forschenden werteten die Daten von 32 Millionen Temperaturmessungen in insgesamt 139 Seen aus, deren Volumen rund 69 Prozent der globalen Süßwasser-Lebensräume ausmacht. Sie wollten wissen, wie sich temperaturspezifische Lebensräume in Seen als Reaktion auf den Klimawandel bereits verändert haben – ob sie geschrumpft sind oder sich ausgedehnt haben. Zu diesem Zweck bestimmten die Forschenden den Unterschied zwischen den aktuellen Wassertemperaturen im Vergleich zu früher. Die Veränderung der temperaturspezifischen Lebensräume wurde als der Prozentsatz quantifiziert, der beim Vergleich der beiden Zeiträume verloren ging oder gewonnen wurde.
Das Ergebnis: Langfristige Änderungen der Wassertemperaturen führten dazu, dass sich die temperaturspezifischen Lebensräume zwischen den Zeiträumen 1978-1995 und 1996-2013 im Mittel um 6 Prozent veränderten. Diese Änderung betrug sogar durchschnittlich 19 Prozent für ausgewählte Arten, die auf eine Jahreszeit und eine Wassertiefe beschränkt sind.
„Insgesamt nehmen warme temperaturspezifische Lebensräume eher zu und kalte eher ab“, sagt Rita Adrian. Arten können mit dem Temperaturanstieg zurechtkommen, indem sie in andere Tiefen ausweichen oder ihr jahreszeitliches Auftreten umstellen. Diese Anpassungen können jedoch durch ökologische Wechselwirkungen, Lebensansprüche oder begrenzte Ressourcen eingeschränkt sein. Zum Beispiel wachsen die meisten Algenarten am besten in den hellen oberen Wasserschichten von Seen. Fische können tiefere, kühlere Regionen von Seen nicht besiedeln, wenn es dort nicht ausreichend Sauerstoff gibt und unterliegen höherem metabolischen Stress.
Seen in den Tropen sind besonders von der Verschiebung der temperaturspezifischen Lebensräume betroffen: Tropische Seen weisen eine geringere Variabilität in den Wassertemperaturen als Seen in den gemäßigten Breiten auf. Werden sie in gleichem Maße wärmer, verschieben sich deshalb ihre temperaturspezifischen Lebensräume in stärkerem Maße. Dies wirkt sich deutlich auf die dort lebenden, oftmals endemischen Arten aus, da deren Toleranz gegenüber Schwankungen in der Temperatur tendenziell geringer ist. Zugleich können veränderte temperaturspezifische Lebensräume zur Folge haben, dass sich invasive Arten ausbreiten. Die Schwarzmund-Grundel ist beispielsweise eine invasive Art, die sehr gut mit verschiedenen Temperaturen zurechtkommt und sich bereits explosionsartig in Gewässern ausgebreitet hat, in denen sie nicht heimisch ist. Invasive Arten können das Nahrungsnetz, die Wasserqualität und die Artenzusammensetzung des besiedelten Ökosystems verändern, außerdem die Ausbreitung von Krankheiten fördern – invasive Krebse übertragen die Krebspest, ohne selbst zu erkranken.
Staudämme verringern Lebensräume in Flüssen
Mit schwindenden Lebensräumen für große Tiere in Flüssen hat sich eine Untersuchung unter Federführung von Sonja Jähnig befasst. Mehr als 3.400 große Wasserkraftanlagen mit über einem Megawatt Leistung sind entweder geplant oder im Bau. Die Forschenden untersuchten die globalen Muster der Flussvernetzung innerhalb der Verbreitungsgebiete großer Süßwassertiere und analysierten, wie sich diese Muster in Zukunft verändern könnten. Der Befund: Besonders die Lebensräume von Süßwasser-Megafauna sind von den Baumaßnahmen bedroht. Falls alle beabsichtigten Staudämme gebaut werden, fragmentieren sie über 600 heute noch frei fließende Flüsse, die länger als 100 Kilometer sind. Über 260 neue Staudämme würden dann 75 große Flüsse wie den Amazonas, Kongo, Salween und Irrawaddy zerschneiden. Weltweit würden 19 Prozent der Flüsse mit über 500 Kilometern Länge, in denen große Tiere vorkommen, ihren Status als frei fließende Gewässer verlieren. Dabei beherbergen die betroffenen Fließgewässer heute noch den höchsten Artenreichtum an großen Tieren – mehr als die dann verbleibenden frei fließenden Flüsse oder solche, die bereits verbaut sind.
Solche Dämme blockieren die Wanderrouten der Süßwasser-Megafauna und könnten zu einer verminderten Fortpflanzung und zur genetischen Isolation führen. Große Süßwassertiere haben oft komplexe Anforderungen an ihren Lebensraum, sind angepasst an das natürliche Fließverhalten, und viele müssen zwischen verschiedenen Lebensräumen wandern, um ihren Lebenszyklus zu vollenden. Auch große Fischarten legen weite Strecken zurück, um sich fortzupflanzen.
„Potenzielle Auswirkungen auf die biologische Vielfalt, insbesondere auf bedrohte und empfindliche Arten, müssen bei der Planung von Wasserkraftwerken berücksichtigt werden“, betont Sonja Jähnig. Konkrete Handlungsempfehlungen für ein nachhaltiges Gewässermanagement, die sich an die Bundespolitik richten, formulierten sie und fünf weitere IGB-Wissenschaftler im Sommer 2021 in einem Policy Brief. Darin bemängeln die Forschenden ein „erhebliches Umsetzungsdefizit“ und fordern unter anderem, Gewässerbelastungen zu vermeiden, zu reduzieren und realistisch zu bepreisen sowie den Schutz der aquatischen Biodiversität als ressortübergreifendes Ziel zu priorisieren.
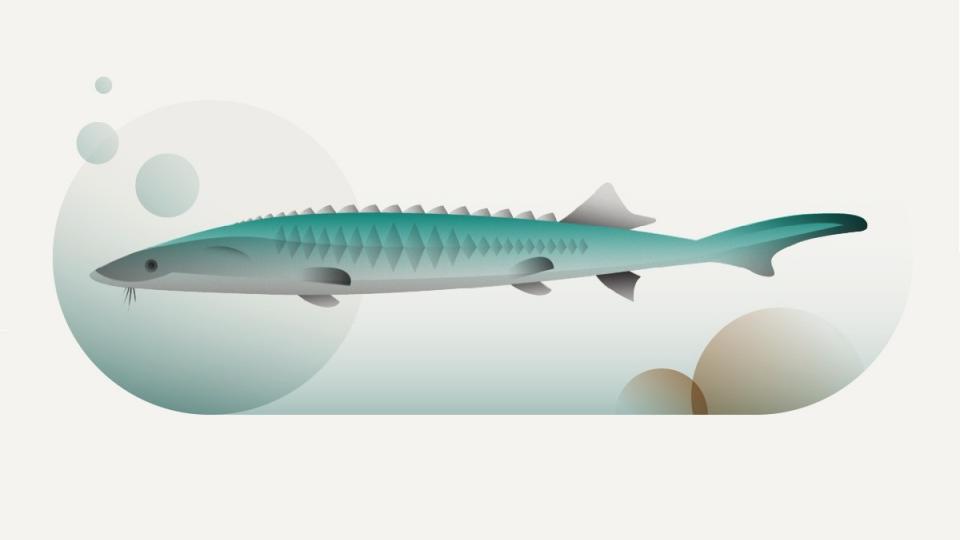
Neben der Fischerei ist die Fragmentierung der Fließgewässer ein Grund dafür, dass der Europäische Stör (Acipenser sturio) beinahe ausgestorben ist. Zwar stellen Hindernisse wie Dämme viele aquatische Lebewesen vor Herausforderungen, Wanderfische werden jedoch besonders stark beeinträchtigt, etwa weil sie ihre Laichplätze nicht mehr erreichen können. | Illustration: www.studioaden.berlin

Der Europäische Biber (Castor fiber) hat in der Vergangenheit einen starken Rückgang seiner Population und seines Verbreitungsgebiets erlebt – bis hin zur Ausrottung in vielen Ländern. Doch mittlerweile ist er wieder in vielen europäischen Regionen zu finden. Der Erfolg ist vor allem Schutzmaßnahmen und Wiederansiedlungsprojekten zu verdanken. | Illustration: www.studioaden.berlin
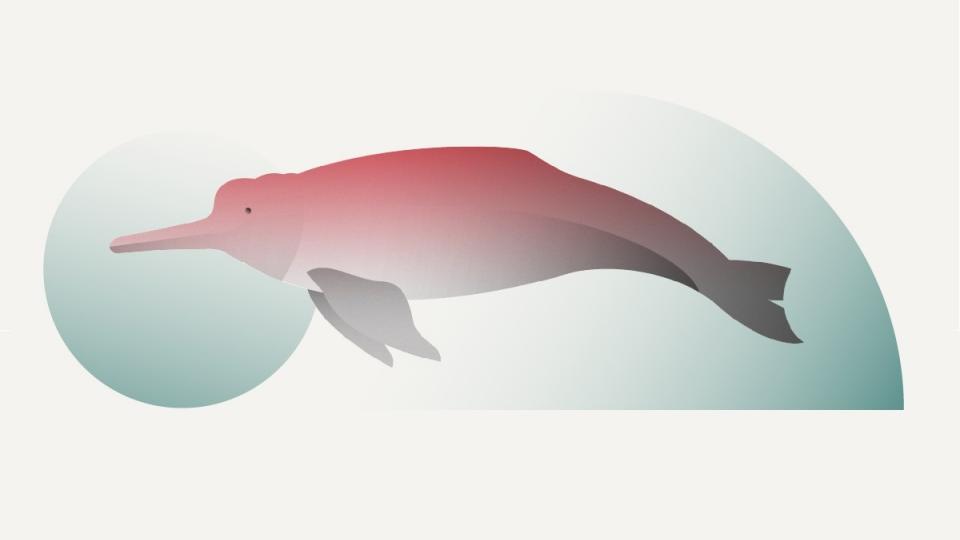
Die Bestände des bis zu 250 cm langen Amazonasdelfins (Inia geoffrensis) schrumpfen insbesondere infolge illegaler Bejagung. Hinzu kommt, dass sich die Tiere in Fischernetzen verheddern, wo sie oft verenden. Auch Staudämme und andere Regulierungsmaßnahmen schränken ihren Lebensraum ein. | Illustration: www.studioaden.berlin

Als einzige Robbenart fühlt sich die Baikalrobbe (Pusa sibirica) ausschließlich im Süßwasser wohl. Die Aufzucht der Jungen erfolgt auf dem Eis, daher könnte die Baikalrobbe durch den Klimawandel gefährdet sein. | Illustration: www.studioaden.berlin








