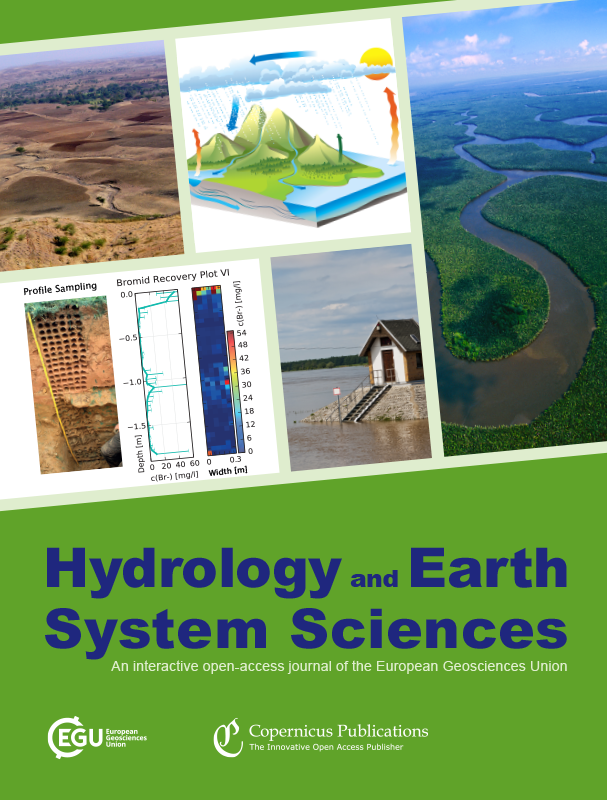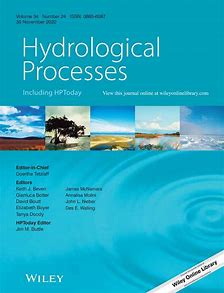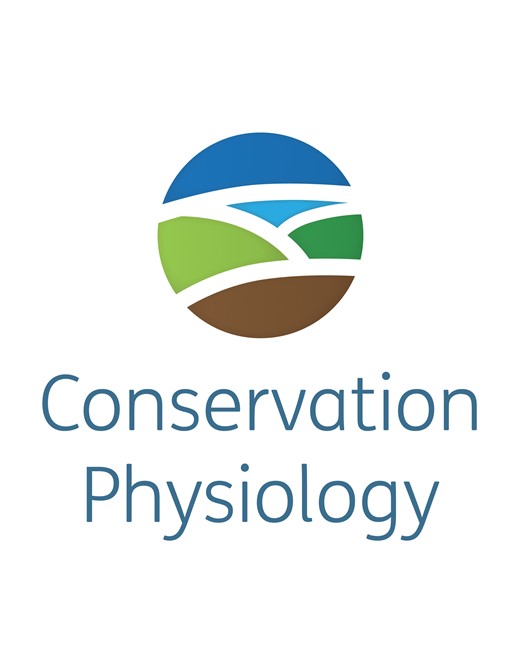- Abteilung:(Abt. 1) Ökohydrologie und Biogeochemie
Eukaryotic rather than prokaryotic microbiomes change over seasons in rewetted fen peatlands
Die Autor*innen untersuchten die jahreszeitliche Dynamik von prokaryotischen und eukaryotischen Mikrobiomen in drei Niedermoortypen Norddeutschlands. Die eukaryotischen Mikrobiome wiesen im Gegensatz zu den prokaryotischen Mikrobiomen signifikante Veränderungen in ihren Gemeinschaftsstrukturen über die Jahreszeiten hinweg auf. Die Dynamik unterschied sich zwischen den Moortypen.
Rewetting does not return drained fen peatlands to their old selves
Die Moorvernässung ist eine effektive Maßnahme Zum Schutz des Klimas, der Gewässer und der Biodiversität. Aufgrund der starken Bodendegradierung ist jedoch kurzfristig nicht mit einer Wiederherstellung ihrer Funktion zu rechnen. Die Analyse von mehreren hundert natürlichen und degradierten Mooren in Europa hat gezeigt, dass damit erst nach mehreren Jahrzehnten zu rechnen ist.
Structural changes to forests during regeneration affect water flux partitioning, water ages and hydrological connectivity: insights from tracer-aided ecohydrological modelling
Die Autor*innen nutzten ein isotopenbasiertes ökohydrologisches Modell, um die hydrologischen Auswirkungen der Wiederaufforstung der schottischen Highlands mit Kiefern zu bewerten. Sie zeigten, dass neue Wälder mehr Wasser durch Evapotranspiration "verbrauchen", was sommerliche Überschwemmungen reduzieren kann, und nach etwa 100 Jahren ein natürlicheres hydrologisches System etabliert sein wird.
Modelling ecohydrological feedbacks in forest and grassland plots under a prolonged drought anomaly in Central Europe 2018–2020
Die Autor*innen monitorten u. modellierten den Wasserhaushalt zwischen Boden-Pflanzen-Atmosphäre von 2018-2020. Das isotopengestützte Modell EcH2O-iso wurde auf Wald u. Grünland in einem grundwasserdominierten Tieflandeinzugsgebiet angewendet. Unterschiede der ökohydrologischen Rückkopplungen in verschiedenen Boden-Vegetations-Einheiten geben Einblicke in den Wasserkreislauf der Kritischen Zone.
Quantifying the effects of urban green space on water partitioning and ages using an isotope-based ecohydrological model
Städtische Grünflächen sind für eine nachhaltige Wasserwirtschaft und zur Hitzereduktion in Städten von großer Bedeutung. Mithilfe von Feldmessungen und einem ökohydrologischen Modell haben Forschende untersucht, wie sich Wasserwege nach Vegetationstyp unterscheiden. Das Ergebnis: Bäume haben potenziell die größte Kühlwirkung, während Gras stärker die Grundwasserneubildung fördert.
Ice-covered lakes of Tibetan Plateau as solar heat collectors
Die Autor*innen untersuchten die thermischen Eigenschaften von tibetischen Seen während der Eisbedeckung. Sie zeigten, dass eine große Menge an Sonnenstrahlung die hochtransparente Eisdecke durchdringt. Infolgedessen mischen sich die Seen unter dem Eis vollständig und werden auf >6°C erwärmt. Die akkumulierte Wärme trägt entscheidend zum Schmelzen der Eisdecke bei.
Transformation of organic micropollutants along hyporheic flow in bedforms of river-simulating flumes
Die Autor*innen untersuchten den Abbau organischer Mikroschadstoffe aus geklärtem Abwasser in Fließrinnen entlang einzelner Fließpfade im Sediment. Oberflächennahe hyporheische Fließfelder u. die kleinskalige Heterogenität der mikrobiellen Gemeinschaft sind wesentliche Einflussfaktoren für die Umwandlung von Schadstoffen in Flusssedimenten.
Misbalance of thyroid hormones after two weeks of exposure to artificial light at night in Eurasian perch Perca fluviatilis
In einer Laborstudie wurde getestet, ob Lichtverschmutzung die Schilddrüsenhormone bei Flussbarschen beeinflusst. Die Tiere zeigten Anzeichen einer Störung des Schilddrüsenstoffwechsels bereits nach einer Exposition von 2 Wochen unter intensiver Straßenbeleuchtung. Ein gestörter Schilddrüsenstatus kann schwere Auswirkungen auf den Stoffwechsel sowie auf die Entwicklung- u. Fortpflanzung haben.
Using isotopes to understand landscape‐scale connectivity in a groundwater‐dominated, lowland catchment under drought conditions
Die Autor*innen untersuchten durch die Integration von hydrometrischen u. Isotopendaten, wie Dürren die Wasserverteilung, Konnektivität u. Abflussbildung auf der Einzugsgebietsskale beeinflussen. Grundwasserneubildung war unter Wald geringer als unter Grasland, u. stieg bei renaturierten Feuchtflächen. Die Konnektivität prägt den Transport gelöster Stoffe u. Interaktionen von Land u. Gewässer.
Quantifying the effects of land use and model scale on water partitioning and water ages using tracer-aided ecohydrological models
Das IGB-Modell EcH2O-iso mit stabilen Isotopen half abzuschätzen, wie unterschiedliche Vegetation in einem Tieflandeinzugsgebiet Niederschlag in Verdunstung und Grundwasserneubildung aufteilt. Waldvegetation führt zu größeren Wasserverlusten in die Atmosphäre bei geringer Grundwasserneubildung. Wasserverluste im Klimawandel können durch sorgfältige Artenauswahl und Management ausgeglichen werden.