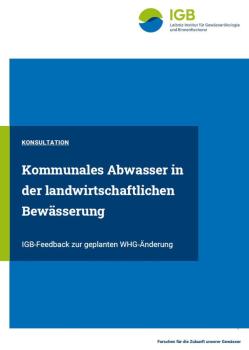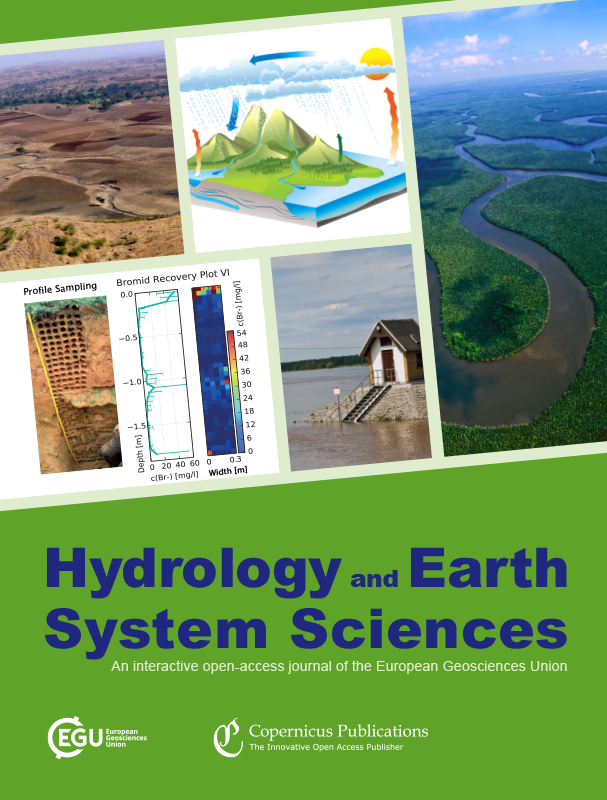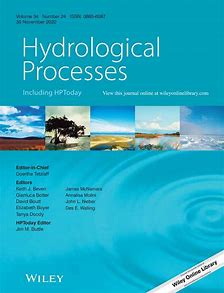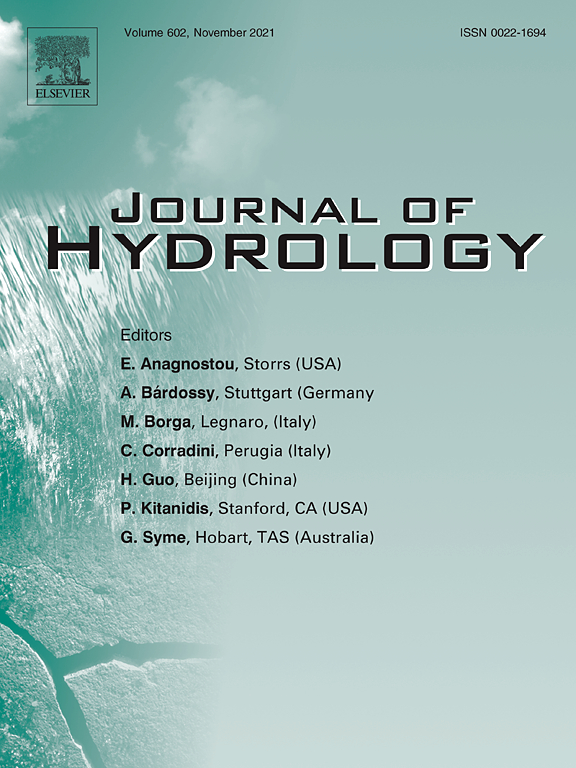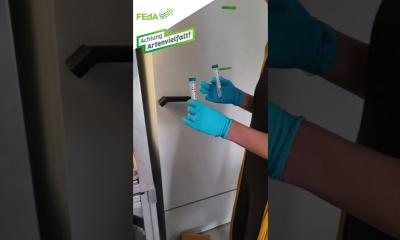Aquatische Ökosysteme sind von Natur aus komplex. In ihnen laufen beständig miteinander vernetze, oft nicht lineare Prozesse auf verschiedenen räumlichen und zeitlichen Ebenen ab. Zu nicht linearen Reaktionen kann es beispielsweise durch Störungen kommen, die einen sogenannten Regimewechsel auslösen, etwa langanhaltende Trockenheit. Wichtige Bestimmungsfaktoren komplexer aquatischer Ökosysteme sind die Landschaftsstruktur, in der sich die Gewässer befinden, und die Konnektivität, also die Verbindung der Gewässer untereinander auf verschiedenen Ebenen.
Im Programmbereich „Dimensionen der Komplexität aquatischer Systeme“ analysieren wir diese Netzwerke, um Dynamik und Verhalten aquatischer Ökosysteme und ihres terrestrischen Umfelds besser zu verstehen. Konkret geht es dabei um Flüsse von Wasser, Energie, Informationen, Nähr- und Schadstoffen sowie um den Beitrag externer Faktoren wie Landnutzung und Klimawandel. Wir nutzen Felduntersuchungen und Monitoring, Data Mining, Experimente und Modellierung. Das Langzeitmonitoring des IGB ist eine Schlüsselkomponente unseres Programmbereichs. Im Fokus unserer Forschung stehen die Schnittstellen und Wechselwirkungen zwischen terrestrischen und aquatischen Lebensräumen, zwischen Sediment und Wassersäule, zwischen Wasser und Luft sowie zwischen und innerhalb von Organismen.
Sprecher*innen
Meldungen
Downloads
Ausgewählte Publikationen
Sub-daily stable water isotope dynamics of urban tree xylem water and ambient vapor
Die Autor*innen kombinierten das In-situ-Monitoring stabiler Isotope und die ökohydrologische Überwachung in verschiedenen städtischen Vegetationsgebieten in Berlin. Sie liefern neue Erkenntnisse über die Pflanzenphysiologie und die hydrologischen Funktionen anhand hochauflösender Isotopendaten, um die Wasseraufnahme und den internen Wasserkreislauf von Pflanzen im Sub-Tages-Rhythmus zu erfassen.

A tiered complexity conceptual framework for treating water soluble, hydrophilic contaminants in green stormwater infrastructure
Blau-grüne Infrastrukturen sind wichtig zur Verbesserung der Qualität von Niederschlagswasser, aber die Entfernung gelöster, hydrophiler Schadstoffe bleibt schwierig. Die Autor*innen schlagen einen mehrstufigen konzeptionellen Rahmen vor, um gelöste, hydrophile Schadstoffe zu entfernen und so die Risiken für Ökosysteme und Trinkwasserquellen zu minimieren.
Hydrological Processes in Lowlands and Plains
Tiefland- und Flachlandgebiete erbringen wichtige Ökosystemleistungen wie land- und forstwirtschaftliche Produktion, Grundwasseranreicherung und Trinkwasserversorgung. Diese Sonderausgabe bündelt wissenschaftliche Beiträge, die das Verständnis der Mechanismen fördern, die der Bewegung und Speicherung von Wasser in Tiefland- und Flachlandgebieten zugrunde liegen.
Knots in the Strings: Do Small-Scale River Features Shape Catchment-Scale Fluxes?
Die Autor*innen untersuchen, wie Fluss-„Knotenpunkte“ im Zusammenhang mit Verzweigungen, Zusammenflüssen und Hindernissen, die räumlich und zeitlich heterogene Abschnitte in einem Flussnetzwerk darstellen, Prozesse auf Abschnittsebene beeinflussen, darunter Strömungsdämpfung, verbesserte vertikale und laterale Konnektivität sowie erhöhte Rückhaltung und Aufnahme von gelösten Stoffen.
Stepwise tracer-based hydrograph separation to quantify contributions of multiple sources of streamflow in a large glacierized catchment over the Tibetan Plateau
Die Autor*innen identifizierten Quellen u. Dynamiken des Oberflächenabflusses in einem Gletschergebiet des Tibetischen Plateaus anhand von isotopischen u. geochemischen Signaturen. Sie zeigen, dass die Einbeziehung hochauflösender Tracerdaten in eine Modellstruktur hilft, den Oberflächenabfluss aufzuschlüsseln u. Dynamiken der Grundwasserneubildung in Gletschergebieten zu identifizieren.