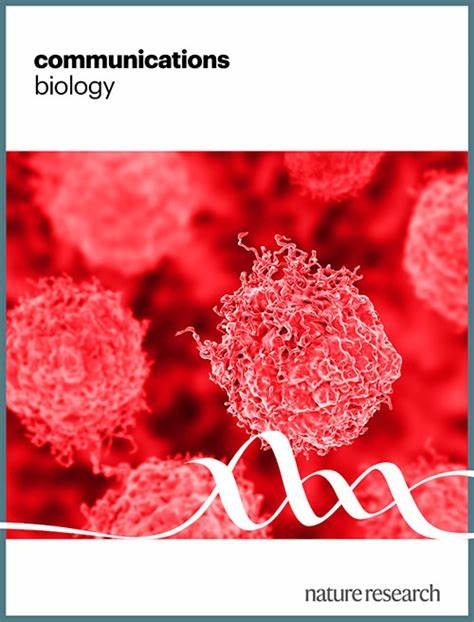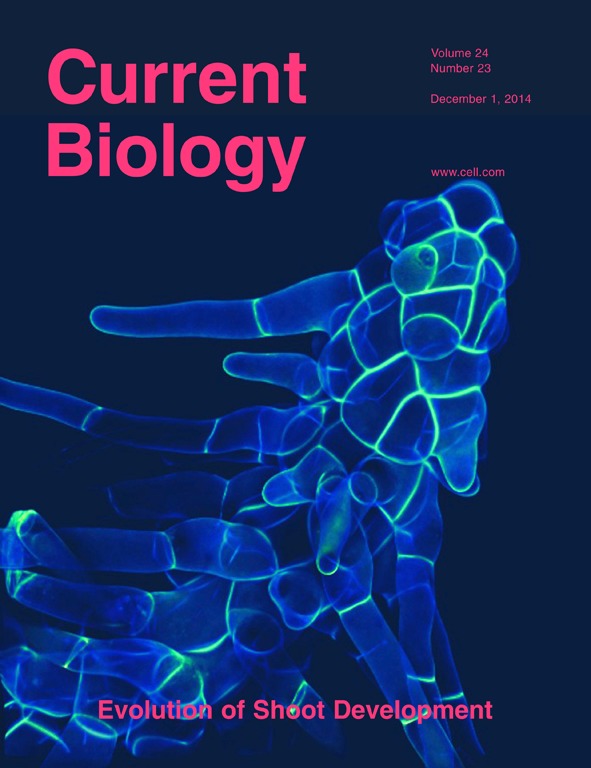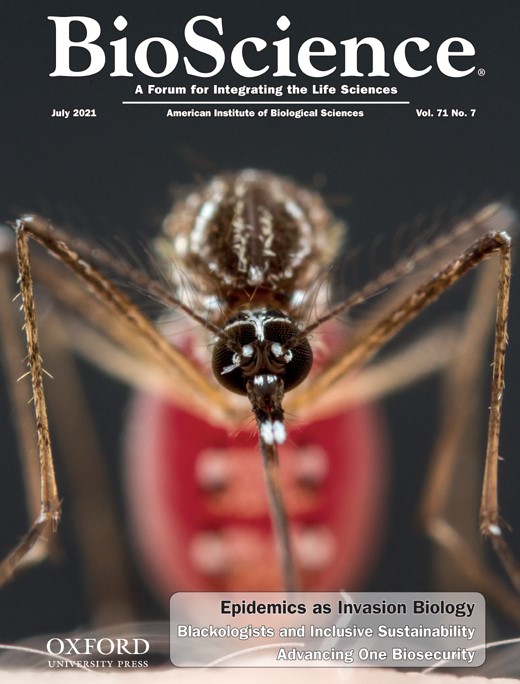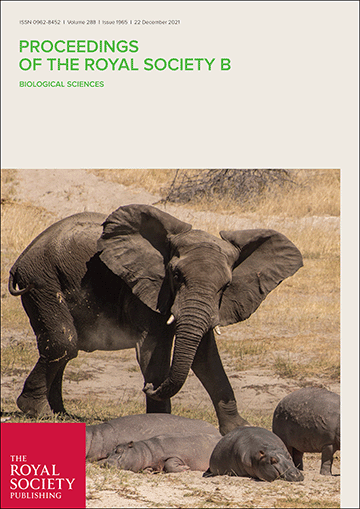(Abt. 5) Evolutionäre und Integrative Ökologie
Wie reagieren Gewässerorganismen auf den globalen Wandel? Mit einem integrativen Ansatz – vom Molekül bis zur Gesellschaft – erforscht Abteilung 5 öko-evolutionäre Prozesse über Zeit und Raum sowie Interaktionen zwischen Arten und Mensch-Natur-Beziehungen. Wir helfen, Gewässersysteme und ihre einzigartige Biodiversität im Anthropozän besser zu verstehen und zu schützen.
Die Abteilung für Evolutionäre und Integrative Ökologie ist sowohl in Friedrichshagen als auch in Dahlem angesiedelt und fördert das öko-evolutionäre Verständnis von Süßwasserorganismen im Anthropozän. Unsere Forschung hat zwei übergreifende Themen:
- Evolutionsökologie und öko-evolutionäre Dynamiken
- Integration über unterschiedliche Skalen, Forschungsfelder und Akteure hinweg
Innerhalb dieser Themenbereiche untersuchen wir mithilfe geeigneter Forschungsmethoden wichtige Fragestellungen, die von den ökologischen und evolutionären Folgen des globalen Wandels (z.B. biologische Invasionen, Klimawandel, Umweltschadstoffe) zu räumlich-zeitlichen Dynamiken und Artinteraktionen wie Konkurrenz, Parasitismus und Räuber-Beute-Beziehungen reichen. Wir untersuchen auch Mensch-Natur-Beziehungen, z.B. in Berlin und anderen urbanen Räumen, und entwickeln neue Methoden zur Synthese wissenschaftlicher Daten und Informationen sowie für den Wissenstransfer.
Wir arbeiten mit Forschenden innerhalb und außerhalb des IGB zusammen, national und international. Besonders enge Verbindungen bestehen zur Freien Universität Berlin und zur KU Leuven, da Abteilungsmitglieder Professuren an diesen Universitäten innehaben. In enger Zusammenarbeit mit anderen Leibniz-Instituten und Universitäten leiten wir das Berliner Zentrum für Genomik in der Biodiversitätsforschung (BeGenDiv). Wir sind auch sehr stark in internationalen Initiativen engagiert, z.B. in der Alliance for Freshwater Life (AFL), Future Earth und der International Union for Conservation of Nature (IUCN).
Forschungsgruppen
Abteilungsmitglieder
Ausgewählte Publikationen
Fundamental questions in meiofauna research highlight how small but ubiquitous animals can improve our understanding of Nature
Diese Studie zeigt 50 Fagen mit Priorität für die Meiofauna-Forschung auf und hebt die Rolle der Meiofauna für die biogeochemischen Kreisläufe und die biologische Vielfalt hervor. Die Autor*innen unterstreichen die Notwendigkeit für eine ausgewogene Forschungsagenda, internationale Zusammenarbeit und Nutzung von technologischen Fortschritten, um das volle Potenzial der Meiofauna zu erschließen.
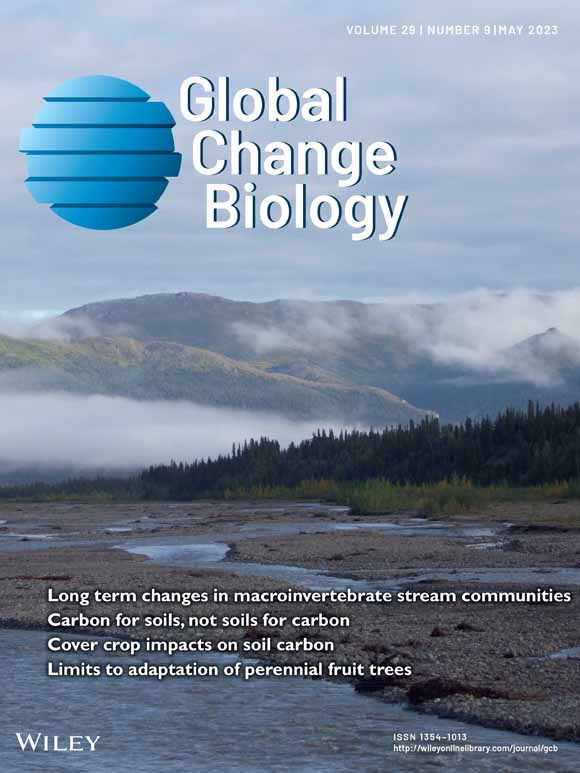
Altered Phenotypic Responses of Asexual Arctic Daphnia After 10 Years of Rapid Climate Change
Arktische Süßgewässer sind Indikatoren für den Klimawandel, aber es ist wenig über das Potenzial für eine schnelle Anpassung der Zooplanktongemeinschaften bekannt. Die Autor*innen wenden die Wiederbelebungsökologie auf eine ungeschlechtliche arktische Daphnienpopulation an und zeigen deren Veränderungen der Temperatur- und Hypoxietoleranz innerhalb einer Dekade auf.
New fish migrations into the Panama Canal increase likelihood of interoceanic invasions in the Americas
Die Autor*innen haben die Fischgemeinschaften des Gatúnsees im Wasserkorridor des Panamakanals vor und nach der Kanalerweiterung 2016 verglichen: Die eingewanderten marinen Fischarten machen inzwischen 76 % des Fischbestandes aus, wodurch sich das Nahrungsnetz im See verändert. Außerdem steigt das Risiko, dass einige Arten den Kanal komplett durchqueren und den gegenüberliegenden Ozean besiedeln.
A conceptual classification scheme of invasion science
Durch die Kombination von Expertenwissen u. Literaturanalyse wurde in der Studie ein konzeptionelles Klassifizierungsschema der Invasionswissenschaft entwickelt. Es ermöglicht, Veröffentlichungen u. Datensätze zu ordnen, Untersuchungen vorzuschlagen u. Wissenslücken zu ermitteln. Das Schema umfasst 5 große Themen, die in 10 Forschungsfragen unterteilt u. mit 39 wichtigen Hypothesen verknüpft sind.
Rapid growth and the evolution of complete metamorphosis in insects
Insekten durchlaufen eine vollständige Metamorphose. Die Autor*innen haben die Frage untersucht, warum sich diese extreme Lebensweise entwickelt haben könnte. Sie kombinierten Wachstumsdaten und mathematische Modellierung und fanden heraus, dass Insekten viel schneller wachsen, wenn sie das Wachstum und den Aufbau des erwachsenen Körpers in zwei getrennten Schritten durchführen.