
Der aus Amerika stammende Feigenkaktus hat in vielen Ländern Einzug in die Kultur gehalten. Hier sind einige Souvenirs aus Sizilien zu sehen. | Foto: Ross Shackleton
Die Studie zeigt, wie einige invasive Arten von der lokalen Bevölkerung als vertraute und geschätzte Elemente ihrer lokalen Umgebung angenommen werden können. „Dies stellt ein Phänomen der ‚kulturellen Integration‘ dar – ein Prozess, bei dem invasive Arten in lokale Traditionen, Identitäten und das Alltagsleben eingebettet werden“, sagt Ivan Jarić, Hauptautor der Studie und Forscher an der Universität Paris-Saclay in Frankreich und der Tschechischen Akademie der Wissenschaften.
Beispiele für kulturelle Integration
Ob es sich nun um eine Pflanzenart handelt, die in traditionellen Rezepten verwendet wird, oder um eine Tierart, die in lokalen Festen gefeiert wird – die kulturelle Akzeptanz dieser Arten verändert die Art und Weise, wie Menschen mit der Natur umgehen. So ist beispielsweise der ursprünglich aus Amerika stammende Feigenkaktus heute in Teilen Afrikas, Asiens und Europas ein vertrauter Anblick. In ländlichen Gebieten sind die Menschen teilweise ökonomisch von ihm abhängig – sie sammeln und verkaufen seine Früchte, die in lokalen Gerichten und Rezepten vorkommen, und nutzen ihn in trockenen Monaten als Futterpflanze. So ist der Feigenkaktus mittlerweile mehr als eine reine Nutzpflanze. Er wird in Volkserzählungen, Kunst und Kunsthandwerk verwendet und ist in manchen Gegenden sogar zu einem lokalen Symbol geworden.
Oder ein Beispiel für eine Feuchtgebietspflanze: Nachdem die invasive Rohrkolbenart Typha domingensis zu einer beliebten Ressource für das Kunsthandwerk geworden war, begannen lokale Gemeinschaften in Mexiko, seine Invasion absichtlich zu fördern, was sich negativ auf das Totora-Schilf Schoenoplectus californicus, eine kulturell und ökologisch wichtige Feuchtgebietspflanze, auswirkte.
Beim Management invasiver Arten den kulturellen Aspekt mitdenken
Kulturelle Integration kann Vorteile mit sich bringen, etwa neue Nahrungsquellen, Freizeitmöglichkeiten oder andere Ökosystemleistungen, aber sie ist auch mit erheblichen Herausforderungen verbunden. Ist eine invasive Art kulturell integriert, wird es für Naturschützer*innen viel schwieriger, sie zu kontrollieren oder zu entfernen. Der öffentliche Widerstand kann wichtige Managementmaßnahmen verzögern oder sogar blockieren. Die Entfernung kulturell integrierter invasiver Arten ist auch nicht unbedingt empfehlenswert und kann negative kulturelle und ökonomische Auswirkungen haben.
„Naturschutzbemühungen sollten nicht nur naturwissenschaftlich sinnvoll sein, sondern auch soziale, kulturelle und wirtschaftliche Aspekte berücksichtigen“, schlägt Jonathan Jeschke vom Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei (IGB) und der Freien Universität Berlin vor, Letztautor der Studie. Ivan Jarić ergänzt: “Entscheidungen sollten auf einer soliden wissenschaftlichen Grundlage beruhen und die Stimmen lokaler Gemeinschaften, Interessengruppen und Rechteinhaber einbeziehen. Alle Beteiligten frühzeitig an einen Tisch zu bringen – vor allem diejenigen, die über Kenntnisse aus erster Hand verfügen – hilft dabei, Vertrauen aufzubauen, Konflikte zu reduzieren und Lösungen zu schaffen, die ökologische, kulturelle und wirtschaftliche Bedürfnisse in Einklang bringen.”
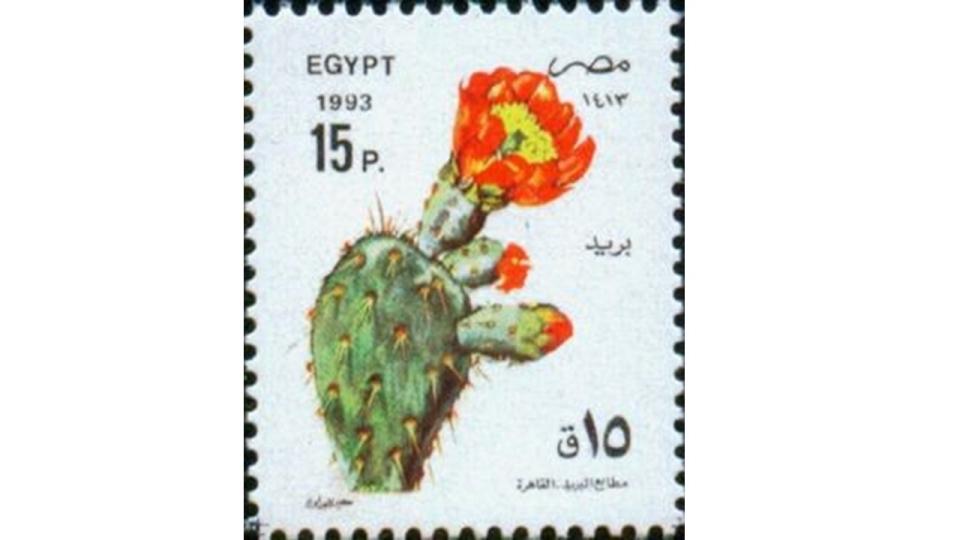
Eine Briefmarke mit Feigenkaktus aus Ägypten. | Foto: Ross Shackleton

Standorte zahlreicher Bars, Restaurants und Unterkünfte in Sizilien, die nach dem Feigenkaktus benannt sind. | Grafik: Ross Shackleton

Feigenkaktus an einem beliebten Touristenstrand in Sizilien. | Foto: Ross Shackleton






