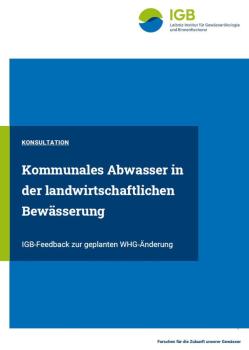Landschafts-Ökohydrologie

Gruppenprofil

Unsere Forschung erlaubt es uns, abzuschätzen, wo und wie viel Wasser in der Landschaft gespeichert wird. Das erlaubt uns, starke Überschwemmungen vorhersagen zu können und Auswirkungen von Trockenperioden abschätzen zu können. | Foto: Lukas Kleine
Unser Ziel ist es, die ökohydrologische Wirkungsweise von Einzugsgebieten auf verschiedenen räumlichen und zeitlichen Skalen zu verstehen, d. h. wie und wie lange Wasser in Landschaften gespeichert und abgegeben wird. Zu diesem Zweck vernetzen wir Landschaften und Flusslandschaften, indem wir die physikalischen Prozesse verstehen, die den Flusslauf erzeugen, und die Art und Weise, wie diese Prozesse die Hydrochemie und Ökohydrologie von Landschaften und Flüssen beeinflussen. Eines unserer wichtigsten Instrumente ist die Verwendung von stabilen Isotopen als "Fingerabdrücke" von Gewässern, um interne Prozesse der Wasserspeicherung, -übertragung und -abgabe sowie ökohydrologische Flüsse zu quantifizieren, die über räumliche und zeitliche Skalen hinweg überwacht werden. Wir integrieren unsere umfangreichen Umweltdaten in ökohydrologische Modelle (die Gruppe hat das Tracer-gestützte Modell EcH2O-iso entwickelt), um ökohydrologische Flüsse und Wechselwirkungen auf physikalische Weise zu parametrisieren. Auf diese Weise können die Auswirkungen der Vegetation auf die Wassernutzung und die direkten Auswirkungen von Klima- und Landnutzungsänderungen auf die Wasserflusswege und die Verfügbarkeit quantitativ bewertet werden.
Tracergestützte Modelle nutzen die gekoppelte Isotopen-Hydrologie-Wasserverfolgung, um stabile Isotopenverhältnisse und ihre Transformation vom Niederschlag in den Fluss durch Flüsse in Vegetationskronen, Wurzelzonen, tieferen Böden und Grundwasserleitern zu simulieren. Mit diesen Ansätzen können wir auch das Alter des Wassers abschätzen. Ein Ziel ist die Untersuchung der Boden-Vegetation-Atmosphäre-Wasser-Dynamik mit Hilfe von Tracern und tracergestützter Modellierung, um die Heterogenität in den räumlich-zeitlichen Mustern der "grünen" (Verdunstung und Transpiration) und "blauen" (Grundwasserneubildung und -abfluss) Wasserflüsse zu quantifizieren und zu ermitteln, wie die Wassernutzung der Pflanzen die Signale eines möglichen Klimawandels beeinflussen und möglicherweise verändern wird. Wir verwenden auch andere von der Gruppe entwickelte Tracer-gestützte Modelle (z. B. STARR).
Derzeit arbeiten wir an den folgenden wichtigen Versuchsstandorten: (i) Das Demnitzer Mühlenfliess im östlichen Brandenburg, Germany, das Boden- und Vegetationsbedingungen aufweist, die für die trockenheitsempfindlichen Teile Nordostdeutschlands und Mitteleuropas repräsentativ sind und in denen die Unterbrechung von Fließgewässern ein großes Problem darstellt; Im Dezember 2023 wurde das Freilandobservatorium in das globale Netzwerk der Ökohydrologie-Demonstrationsstandorte des Intergovernmental Hydrological Programme der UNESCO (UNESCO-IHP) aufgenommen; (ii) im Stadtgebiet von Berlin, wo wir auch ein umfassendes Monitoring der Wechselwirkungen zwischen Atmosphäre, Boden, Vegetation und Flusslauf durchführen, um diese Prozesse im städtischen Umfeld zu verstehen und so die Entscheidungsfindung für eine nachhaltige Stadtentwicklung zu unterstützen; (iii) die Flussauen des Nationalparks Unteres Odertal, um die Dynamik der Vernetzung von Auen und Flüssen zu verstehen; (iv) Das Sophienfließ bei Buckow, Märkische Schweiz, wo wir die hydrologische, Wasserqualitäts- und Wasserisotopendynamik in einem durch Biberaktivitäten beeinflussten Steilwassereinzugsgebiet in Brandenburg verstehen wollen; (v) das Einzugsgebiet des Girnock Burn in Nordost-Schottland, das für nördliche Klimazonen mit tief liegenden organischen Böden charakteristisch ist. Schließlich nutzen wir auf der Grundlage lokaler Verarbeitungsprozesse Erkenntnisse aus verschiedenen geografischen Umgebungen aus internationalen Vergleichen zwischen Einzugsgebieten, um ein ganzheitlicheres Verständnis der hydrologischen und ökologischen Funktion zu gewinnen.
Unsere Forschung liefert neue wissenschaftliche Erkenntnisse darüber, wie sich unterschiedliche Landnutzungen auf die Verteilung von "grünem" und "blauem" Wasser auswirken. Dies ist eine wichtige Grundlage für die Bewertung, wie die Dynamik der Wasserspeicherung und -flüsse durch Landbewirtschaftungsstrategien beeinflusst werden kann, um die ökohydrologische Widerstandsfähigkeit zu erhöhen und die Wasserressourcen vor dem künftigen Klimawandel zu schützen.
Innerhalb Abteilung 1, Ökohydrologie & Biogeochemie, deckt unser Team die drei Schwerpunktthemen der Abteilung ab: Landschafts-Wasser Interaktionen; Ökohydrologie und Biogeochemie urbaner und gestörter Systeme; sowie abiotische und biotische Vernetzungen.
Einige Beispiele aktueller Projekte
(i) Studien zu ländlichen Gebieten in Brandenburg
Modellierung der räumlich-zeitlichen Muster von hydrologischen und Wasserqualitätsprozessen auf der Ebene von Wassereinzugsgebieten (Wu et al., 2022, Disentangling the influence of landscape characteristics, hydroclimatic variability and land management on surface water NO3 ‐N dynamics: spatially distributed modelling over 30 years in a lowland mixed land use catchment. Water Resources Research) und Feuchtgebieten (Wu et al., 2022, Tracer-aided identification of hydrological and biogeochemical controls on in-stream water quality in a riparian wetland. Water Research) um die Rolle von Klima, Landnutzung, Vegetation, Topografie und anderen lokalen Einflussfaktoren zu bewerten; Bewertung der Unsicherheit bei der Kalibrierung verteilter hydrologischer Modelle (Wu et al., 2022, Identifying Dominant Processes in Time and Space: Time-varying Spatial Sensitivity Analysis for a Grid-based Nitrate Model. Water Resources Research) (Doktorarbeit Songjun Wu)
Verwendung von Tracer-gestützten ökohydrologischen Modellen zur Bewertung der langfristigen Auswirkungen von Dürren auf die Wasserspeicherung in der Landschaft und der Auswirkungen alternativer Landnutzungsstrategien auf die Optimierung der Wasserverfügbarkeit in dürreempfindlichen Einzugsgebieten (Dr. Shuxin Luo). Luo et al., 2024, Long-term drought effects on landscape water storage and resilience under contrasting landuses. Journal of Hydrology. Dieses Projekt, das darauf abzielt, die sich abzeichnenden Herausforderungen anzugehen und Strategien für koordinierte Maßnahmen in der Modellregion Berlin-Brandenburg zu entwickeln, wird von der Einstein Research Unit Climate and Water under Change (CliWaC) gefördert.
Untersuchung der jährlichen Schwankungen der Wasserqualität in einem intermittierenden Fluss unter Trockenheitsbedingungen und hochauflösende Wasserqualitätsdynamik von Uferfeuchtgebieten in nährstoffreichen Flachland-Einzugsgebieten (Doktorarbeit Famin Wang).
Verständnis der Grundwasser-Oberflächenwasserdynamik in einem gemischt genutzten Flachland-Einzugsgebiet durch die Integration von stabilen Wasserisotopen, Hydrochemie, geophysikalischen Methoden und Modellierung (Ying et al., 2024, Developing a conceptual model of groundwater – surface water interactions in a drought sensitive lowland catchment using multi-proxy data. Journal of Hydrology) (Doktorarbeit Zhengtao Ying).
Bewertung der räumlich-zeitlichen Wechselwirkungen zwischen Speicherung, Fluss, Isotopen und Wasseralter sowie der Aufteilung von "blauem" (Grund- und Oberflächenwasser) und "grünem" (Evapotranspiration) Wasser im Einzugsgebiet des Demnitzer Mühlenfließes unter Verwendung des tracer-gestützten ökohydrologischen Modells EcH2O-iso (Dr. Aaron Smith) e.g. Smith et al., 2022; Critical zone response times and water age relationships under variable catchment wetness states: insights using a tracer-aided ecohydrological model. Water Resources Research; Smith et al., 2021, Quantifying the effects of land use and model scale on water partitioning and water ages using tracer-aided ecohydrological models. Hydrology and Earth System Science. (HESS); Kleine et al., 2021, Modelling ecohydrological feedbacks in forest and grassland plots under a prolonged drought anomaly in central Europe 2018-2020. Hydrological Processes.
Einsatz von stabilen Wasserisotopen und ökohydrologischer Überwachung zur Untersuchung der Zusammenhänge zwischen dem Kontinuum Boden-Pflanze-Atmosphäre sowie der Auswirkungen bestimmter Landnutzungstypen (Wald, Landwirtschaft und Grünland) auf die ökohydrologischen Prozesse im Einzugsgebiet des Demnitzer Mühlenfließes (Doktorarbeit Jessica Landgraf); e.g. Landgraf et al. (2022) Using stable water isotopes to understand ecohydrological partitioning under contrasting land uses in a drought-sensitive rural, lowland catchment. Hydrological Processes.
Untersuchungen an der Spree: Großflächige synoptische Untersuchungen unter Verwendung von stabilen Wasserisotopen (Doktorarbeit Ke Chen) Chen at al., 2023, Synoptic water isotope surveys to understand the hydrology of large intensively managed catchments. Journal of Hydrology; und Nitrate (Liu et al., 2023, Quantifying changes and trends of NO3 concentrations and concentration-discharge relationships in complex large, heavily managed river systems. Journal of Hydrology), (Dr Ji Liu) zum Verständnis der Hydrologie und der Beziehungen zwischen Konzentration und Abfluss in einem großen, intensiv bewirtschafteten Einzugsgebiet.
(ii) Forschung in städtischen Ökosystemen Berlins
Einsatz von stabilen Wasserisotopen und Umwelt-DNA zur Untersuchung der Zusammenhänge zwischen mikrobiellen Gemeinschaftsmustern und Hydrologie sowie anderen biotischen und abiotischen Faktoren in städtischen Fließgewässern, um die Widerstandsfähigkeit und das Funktionieren der städtischen blau-grünen Infrastruktur zu bewerten und die Planung und Wiederherstellung naturbasierter Lösungen in Städten zu verbessern: BiNatUr – Bringing Nature Back (Dr. Maria Warter). Warter et al., 2024, Environmental DNA, hydrochemistry and stable water isotopes as integrative tracers of urban ecohydrology. Water Research.
Mithilfe von In-situ-Messungen von Isotopen in Pflanzenxylem und atmosphärischem Dampf und synoptischen Probenahmen zur Untersuchung der hochauflösenden ökohydrologischen Prozessdynamik an der städtischen Boden-Pflanzen-Atmosphären-Grenzfläche (Doktorarbeit Ann-Marie Ring; gehört zur DFG Graduiertenschule Graduate school Urban Water Interfaces UWI) Ring et al., 2024 Assessing the impact of drought on water cycling in urban trees via in-situ isotopic monitoring of plant xylem water. Journal of Hydrology; und zeitlich hochauflösenden In-situ-Messungen von Feuchtigkeit, Energiebilanz und Tracern mit dem tracergestützten ökohydrologischen Modell EcH2O-iso erforschen wir die komplexen Mischungs- und Transitzeiten sowie die Wechselwirkungen von Vegetation und Bodenwasser (Dr. Aaron Smith); e.g. Smith et al. (2022) Modelling temporal variability of in-situ soil water and vegetation isotopes reveals ecohydrological couplings in a willow plot. Biogeosciences.
Im Rahmen von UWI wenden wir auch tracergestützte ökohydrologische Modelle an, um die Auswirkungen der fortschreitenden Verstädterung auf die Komponenten des Wasserhaushalts in städtischen und stadtnahen Einzugsgebieten zu untersuchen, um Nichtlinearitäten in ihren langfristigen Reaktionen über Zeiträume hinweg zu vergleichen und zu bewerten, die trockene und nasse Jahre einschließen (Dr. Gregorio López Moreira) López Moreira Mazacotte et al., 2024, Integrated monitoring and modeling to disentangle the complex spatio-temporal dynamics of urbanized streams under drought stress. Environmental Monitoring and Assessment.
Anhand von Messungen der Bodenfeuchtigkeit sowie stabiler Isotope im Boden- und Xylemwasser mit dem tracergestützten ökohydrologischen Modell EcH2O-iso untersuchen wir die Unterschiede in der Wasserverteilung zwischen Stadtbäumen und Grasland. Diese Forschung kann beispielsweise politischen Entscheidungsträgern dabei helfen, die Nutzung von städtischen Grünflächen zur Bekämpfung der städtischen Hitze oder zur Förderung der Grundwasseranreicherung zu optimieren; z. B. Gillefalk M, et al. (2021) Quantifying the effects of urban green space on water partitioning and ages using an isotope-based ecohydrological model. Hydrology and Earth System Sciences (HESS).
Mit Hilfe stabiler Wasserisotope und der Hydrochemie als natürliche "Fingerabdrücke" des Wassers wollen wir verstehen, wie Wasser durch die städtische Umwelt transportiert wird, und zwar im Hinblick auf Wasserquellen, -pfade und -alter, um die Auswirkungen der Urbanisierung auf den Wasserhaushalt zu entschlüsseln (Doktorarbeiten Lena-Marie Kuhlemann, Christian Marx); z. B. Kuhlemann et al. (2022) The imprint of hydroclimate, urbanization and catchment connectivity on the stable isotope dynamics of a large river in Berlin, Germany. Journal of Hydrology. Marx et al. (2022) Spatial variations in soil-plant interactions in contrasting urban green spaces: preliminary insights from water stable isotopes. Journal of Hydrology.
(iii) Forschung in den Flussauen der Oder
Quantifizierung der Konnektivitätsdynamik zwischen einem großen Fluss, der Oder, und seinem Überschwemmungsgebiet unter Verwendung von stabilen Wasserisotopen, Wasserqualität und Fernerkundungsansätzen: Zheng et al., 2024 Quantifying intra- and inter-annual dynamics of river-floodplain connectivity and wetland inundation with remote sensing and wavelet analysis. Hydrological Processes (Doktorarbeit Hanwu Zheng).

Besprechung im Isotopenlabor. | Foto: David Ausserhofer
Verschiedene Landnutzungen in einem Tiefland-Einzugsgebiet im Nordosten Deutschlands. | Foto: Dörthe Tetzlaff

Das Isotopenlabor am IGB. | Foto: David Ausserhofer
Schottische Kiefernvegetation entlang Tanar River, Schottland. | Foto: Dörthe Tetzlaff
Wir wollen die Speicherung und die Wege des Wasser verstehen, um starke Überschwemmungen vorhersagen zu können und zu verhindern. | Foto: Chris Soulsby

Unsere Forschung erlaubt es uns, abzuschätzen, wo und wie viel Wasser in der Landschaft gespeichert wird. Das erlaubt uns, starke Überschwemmungen vorhersagen zu können und Auswirkungen von Trockenperioden abschätzen zu können. | Foto: Lukas Kleine
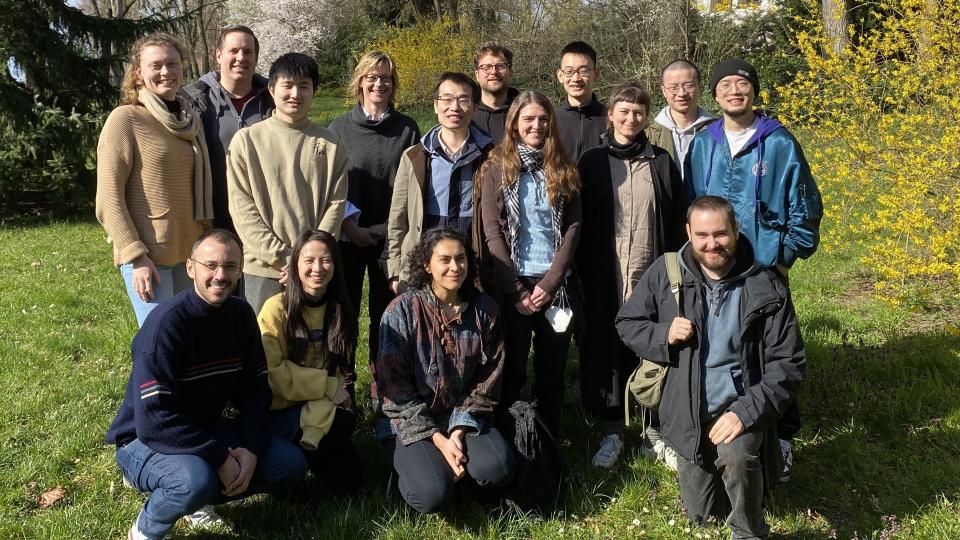
Die Forschungsgruppe im April 2023. | Foto: IGB

Eine der Messstationen im Demnitzer Mühlenfließ. | Foto: Jonas Freymüller
Moorlandschaft | Foto: Dörthe Tetzlaff
Moorlandschaft | Foto: Dörthe Tetzlaff